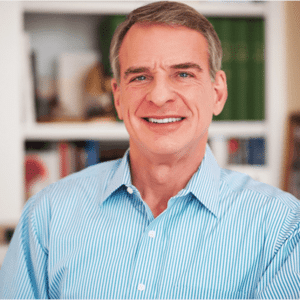#355 Noch einmal: Über den Schmerz in der Tierwelt
January 14, 2016
F
Einleitung von Prof. Dr. Craig:
Ich habe in Dr. Michael Murrays Buch über den Schmerz in der Tierwelt – oder vielleicht wäre es besser, vom „Leiden in der Tierwelt“ zu sprechen – eine sehr anregende und hilfreiche Lektüre gefunden. Nachdem ich das Buch in verschiedenen Debatten erwähnt hatte, haben manche Zuhörer/Leser zu seinen Argumenten Stellung bezogen, was Leser der Website „Reasonable Faith“ dazu veranlasste, ihrerseits Fragen zu diesem Thema zu stellen. Diesen kritischen Entgegnungen stellt sich Dr. Murray auf meine Einladung an dieser Stelle. Was ich an seinen Äußerungen (siehe unten) sehr interessant finde: Er selbst bezieht sich nur indirekt auf das, was ich an seinen Antworten für einen seiner stärksten Punkte halte: Tiere haben im Gegensatz zum Menschen keine „Erste-Persons-Erfahrung“, kein reflexives Bewusstsein ihres Erlebens, und das gilt auch für Erfahrungen wie den Schmerz. Ihr Schmerzerleben ist nicht vom Gedanken wie: „Mir ist, als …“ oder „ich fühle, dass …“, begleitet. Tiere sind sich also beim Erleiden von Schmerzen der Tatsache ihres Schmerzempfindens nicht bewusst. Ganz unabhängig davon zeigt Dr. Murray: Seine Kritiker konnten nicht zeigen, dass das Leiden der Tiere von „moralischem Belang“ wäre.
United States
Prof. Craigs Antwort
A
Prof. Dr. Michael Murrays Antwort
In meiner berufsphilosophischen Laufbahn habe ich versucht, auf Fragen einzugehen, die ich zu den schwierigsten Herausforderungen der Vernunft bezüglich des christlichen Glaubens zähle: Die Verborgenheit Gottes, den naturalistischen Ansatz zum Ursprung der Religionen, die Realität der Hölle usw. In meinem Buch „Nature Red in Tooth and Claw“ (erschienen 2008, Oxford University Press) widme ich mich einer weiteren Herausforderung: dem Problem des Bösen, wie es sich im Schmerz, im Leiden und im Tod der Tiere zeigt, insbesondere wenn man es im Licht der derzeit geltenden Evolutionstheorie betrachtet. Seit Darwin haben Kritiker des Christentums behauptet, Ausmaß, Dauer, Intensität und Umfang des Bösen (Phänomene, die sich aus dem Darwinismus zwingend ergeben) lieferten einen schlagkräftigen Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Das Buch widmet sich der Frage: Können diese Phänomene diesen „Beweis“ wirklich erbringen?
Das Buch bespricht verschiedene Möglichkeiten, wie man als Christ mit der Frage nach dem Problem des Leidens in der Tierwelt umgehen kann. Ich gehe auf jede einzelne dieser Möglichkeiten ein. Ziel war dabei nicht, die Antwort auf das „Problem des Leidens in der Tierwelt“ zu geben, sondern einige der Antwortmöglichkeiten zu untersuchen und sie auf ihre Stärken und Schwächen hin abzuklopfen.
Ich freue mich, sagen zu können, dass das Buch nicht wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Wie jedes gute Buch zu philosophischen Fragen enthält es kontroverse und herausfordernde Argumente. Viel Aufmerksamkeit erregte ein kleiner Teil eines Arguments, das ich im 2. Kapitel bespreche; ein Argument, auf das ich an dieser Stelle noch einmal eingehen möchte. Verschiedene Denker haben kritische Stellungnahmen dazu veröffentlicht. Nachdem sich William Lane Craig in seinen öffentlichen Debatten darauf bezogen hatte, wurde es so etwas wie eine cause célèbre. Leute, denen Craigs Umgang mit diesem Argument nicht passt, haben behauptet, das Argument sei wissenschaftlich nicht haltbar. Einige sind sogar so weit gegangen, ihn aufzufordern, sich für den Gebrauch dieses Arguments zu entschuldigen (!) Das Argument ist nun sogar Gegenstand mindestens zweier „Enthüllungsberichte“ auf YouTube geworden; diese wurden auf Dutzenden Webseiten verlinkt und zitiert.
Was genau hat diesen Zirkus ausgelöst? Bevor ich dazu komme, lassen Sie mich einige einleitende Worte zu dem Argument selbst verlieren. Mein Buch verfolgt die Absicht, Argumente zu widerlegen, die behaupten, die Realität des Leidens in der Tierwelt sei ein guter Grund, an die Nichtexistenz Gottes zu glauben. Wie bei den meisten Argumenten zur „Problematik des Bösen“ wird die Existenz des Bösen schon vorausgesetzt; es bestehe also aus moralischer Sicht kaum Grund, dass Gott ein solches Übel zulassen sollte. Wenn es einen Gott gäbe, dann dürfte dieses Übel nicht existieren. Nun existiert es aber. Daher gibt es keinen Gott.
Um dagegenzuhalten, müsste aber entweder gezeigt werden (1), dass das Übel (des tierischen Leidens) als „Übel“ gar nicht existiert (oder dass wir kaum in einer guten Position sind, eine solche Existenz zu bekräftigen) oder (2) dass es moralisch ausreichend Grund gibt für Gott, dieses Übel zuzulassen. (Oder dass wir aus unserer Sicht nicht sagen können, ob Gott ausreichende Gründe hat, es zuzulassen.) In meinem Buch versuche ich, all diese Punkte zu berücksichtigen, um das im vorigen Abschnitt erwähnte Argument gegen Gottes Existenz zu widerlegen.
Im 2. Kapitel beschäftige ich mich hauptsächlich mit Option 1. Ich betrachte dort Argumente, die davon ausgehen, Schmerz und Leiden eines Tieres seien nicht real bzw. wir befänden uns in keiner guten Ausgangslage, um dies recht beurteilen zu können.
Es ist unnötig, zu erwähnen: Es gibt wohl nicht viele Menschen, die so etwas behaupten. Jeder, der sich Naturfilme angesehen hat, auf einem Bauernhof oder in einem Zoo gewesen ist oder gar selbst ein Haustier besitzt, weiß ganz genau: Ein Tier fühlt Schmerz und kann auch leiden! Wer wird denn so unsensibel sein, dies zu leugnen? Wahrscheinlich niemand. Dennoch sind Philosophen stets bereit, kontraintuitive Positionen zu untersuchen, um zu sehen, was sie gegebenenfalls abwerfen können. Und in diesem Kapitel tue ich genau das.
Die Argumente in diesem Kapitel sind einigermaßen kompliziert; ich kann sie hier nicht en détail wiederholen. Kurz gesagt, gehe ich der Frage nach: Wie hoch ist unsere Berechtigung, anzunehmen, Tiere erlitten eine Art von Schmerz und Leid, die wir als „böse“ bezeichnen? Das mag nun zugegebenermaßen seltsam klingen, denn man kann schließlich alle Formen des Schmerzes und Leidens in diese Kategorie einordnen. Aber genau da wird es knifflig.
Ein Organismus ist in seiner Umwelt vielen Gefahren ausgesetzt. Manche dieser Gefahren bedrohen das Wohlbefinden bzw. das Leben des Organismus’. Schmerztheoretiker bezeichnen diese Gefahren als „gesundheitsschädliche Reize“ (engl. noxious stimuli). Tiere reagieren verschieden auf diese „gesundheitsschädlichen Reize“. In den meisten Fällen kommt es zu einer Art Abwehrverhalten, das den jeweiligen Organismus vor der drohenden Gefahr schützen und in Sicherheit bringen soll.
Manchmal führen diese „gesundheitsschädlichen Reize“ zu Schmerz, manchmal nicht. Wenn ich meine Hand von der heißen Herdplatte zurückziehe, dann freilich im Schmerz. Zieht sich die Schnecke nach einer Berührung in ihr Häuschen zurück, fühlt sie dabei keinen Schmerz (ihr fehlt dafür einfach die notwendige nervliche Komplexität). Die Frage lautet also: Wann führen „gesundheitsschädliche Reize“, wann führt ein Aversionsverhalten dazu, dass ein Tier Schmerz fühlt und wann nicht? Eine äußerst schwierige Frage. Um diese Frage beantworten zu können, müssten wir nicht in Erfahrung bringen, ob Tiere auf gesundheitsschädliche Reize reagieren können (das bezweifelt niemand), sondern wir müssten wissen, ob sie die Schmerzempfindung den gesundheitsschädlichen Reizen zuordnen können, die sie (manchmal) verursachen.
Hierfür bräuchten wir eine Theorie über die Bedeutung von „Schmerz“ oder allgemeiner gesagt über das „Fühlen“ selbst. Wie sich herausstellt, ist dies jedoch eine der schwierigsten Fragen der Philosophie des Geistes, ja, der Philosophie überhaupt. Ein „Fühlen“ in diesem Sinn ist auch als „phänomenales Bewusstsein“ bekannt.
In Kapitel 2 meines Buches untersuche ich verschiedene Denkansätze zum phänomenalen Bewusstsein und dessen Implikationen für das Problem des tierischen Leidensvermögens. Eine Theorie, der ich stärker auf den Zahn fühle, ist als „Higher Order Thinking“ (kurz HOT, dt. etwa Abstraktionsvermögen des Bewusstseins; eigentlich „Denken höherer Ordnung") bekannt geworden. So können wir zwischen geistigen Zuständen basaler Natur und solchen höherer Ordnung unterscheiden. Für „Gefühle“ oder phänomenales Bewusstsein ist ein Zustand höherer Ordnung erforderlich. Das Phänomen des „Blindsehens“ ist ein Beispiel für einen solchen Geisteszustand: Patienten mit einer bestimmten Art Gehirnverletzung berichten, sie seien blind, seien aber dennoch in der Lage, Hindernissen aus dem Weg zu gehen, indem sie sie mit eigenen Augen „sehen“. Wie können wir dies erklären? Antwort: Patienten mit Blindsicht können die Hindernisse zwar sehen, sind sich dessen aber nicht bewusst. In gewisser Hinsicht sind sie sich der Gegenstände zwar bewusst (das wird manchmal als „Zugriffsbewusstsein“ (engl. access consciousness [1]), nicht aber im Sinne des „phänomenalen Bewusstseins“. Die HOT-Theorie („Abstraktionsvermögen des Bewusstseins“) könnte eine plausible Erklärung dieses Phänomens liefern.
Wenn wir also die Reaktion eines Tieres auf Schmerz sehen, dann fragen wir zu Recht: „Fühlen“ Tiere Schmerz im Sinne eines „phänomenalen Bewusstseins“ oder haben sie nur eine Art „Zugriffsbewusstsein“ [2] durch „gesundheitsschädliche Reize“? Wenn die HOT-Theorie stimmt, haben Tiere nur dann ein phänomenales Bewusstsein (ihres Schmerzes), wenn sie sich auf einer höheren mentalen Ebene jener niedrigeren Geisteszustände bewusst sind, die durch den gesundheitsschädlichen Reiz verursacht werden. Es ist aber kaum in Erfahrung zu bringen, ob Tiere über so etwas wie „höhere Geisteszustände“ verfügen. Man müsste herausfinden, welche Art von Verhalten bzw. welche nervlichen Hinweise dies bestätigten. Wenn wir also nicht wissen, ob Tiere über eine Art „phänomenales Schmerzbewusstsein“ verfügen – und genau darauf kommt es an, wenn man den Schmerz der Kategorie „schlimm“ oder „böse“ zuzählen will –, dann wissen wir auch nicht, ob es so etwas wie ein „Problem des tierischen Leidens“ überhaupt gibt. Nennen wir dies Antwort 1 auf das Problem des Leidens im Tierreich.
Argumente dieser allgemeineren Natur sind vom Standpunkt der zeitgenössischen Bewusstseinsforschung und Philosophie des Geistes aus gesehen keineswegs kontrovers, auch wenn die meisten Menschen wohl instinktiv davon überzeugt sind, dass Tiere Schmerzen empfinden. Interessanterweise ist es aber gerade nicht dieses Argument, was zu so viel Wirbel im Netz und auf YouTube geführt hat. Um in den Kern dieser Kontroverse vorzudringen, müssen wir uns das nächste Argument ansehen.
Ich bespreche in Kapitel 1 (in einem späteren Abschnitt) eine weitere seltsame Möglichkeit tierischer Wahrnehmung: Stellen wir uns vor, Tiere haben „Geisteszustände höherer Ordnung“ und können sich „gedanklich“ auch irgendwie auf diese Zustände beziehen. Sie verfügen damit auch über ein Schmerzbewusstsein. Beweist dies, dass Tiere leiden? Nicht unbedingt, und zwar aus folgendem Grund: Das menschliche phänomenale Bewusstsein fühlt sich entweder gut (etwa beim Genuss von Schokolade), schlecht (z. B. bei Schwefelgeruch) oder neutral (z. B. beim Anblick der Farbe „rot“). Könnte es sein, dass Tiere zwar ein Schmerzbewusstsein haben, dass sich dieses Gewahrsein aber nicht qualvoll anfühlt? Klingt das nicht lächerlich? Wie können Tiere Schmerzempfindungen haben, ohne darunter zu leiden?
So seltsam es klingen mag, wissen wir doch von einigen Fällen, in denen das phänomenale Schmerzbewusstsein gerade nicht von Qual gekennzeichnet war. In den 40ern und 50ern des vorigen Jahrhunderts war der chirurgische Eingriff, den wir heute unter dem Begriff „Stirnhirnausschaltung“ (engl. frontal lobotomy) kennen, kaum verbreitet. Während dieses sehr groben Eingriffs entfernte der Chirurg Teile der frontalen Hirnrinde des Patienten. Das Ergebnis war überraschend. In einigen Fällen operierte man, um den chronischen Schmerz eines Patienten auszuschalten. Das klappte nicht in allen Fällen, aber es waren Fälle darunter, bei denen sich etwas Sonderbares ereignete – die Patienten gaben an, dass sie ihren Schmerz zwar noch fühlen könnten, er sie aber nicht mehr „quäle“.
Solcher Fälle wegen stellte ich folgende Frage: Was wäre, wenn das tierische Schmerzempfinden diesem Phänomen ähnelte? Was wäre, wenn der entsprechende „Geisteszustand“ schmerzempfindender Tiere keine negative Wertigkeit hätte? Anders gefragt: Was wäre, wenn Tiere auf dieselbe Weise Schmerz empfänden wie jene Patienten, denen man Teile des präfrontalen Kortex entfernt hatte? Dürfte man dann noch von dem „Problem des tierischen Schmerzes“ sprechen? Ich bestreite das. Wenn es so ist, dann empfinden Tiere zwar Schmerz, „leiden“ aber nicht unter ihm. Nennen wir dies Antwort 2 auf das Problem des Leidens im Tierreich.
Wissen wir denn, ob eine der beschriebenen Möglichkeiten auf Tiere zutrifft? (Antwort 1: Das tierische Schmerzempfinden entspricht der Blindsicht – es wird erlebt, aber nicht empfunden. Antwort 2: Es entspricht dem „Schmerzempfinden“ nach einer Lobotomie, wird also zwar empfunden, aber nicht als Qual.) Nein, das wissen wir nicht. Können wir aber von dem Gegenteil ausgehen? Ich behaupte: auch nicht. Die Tendenz geht dahin anzunehmen, dass ein Tier Schmerzen auf eine der soeben beschriebenen Arten und Weisen empfindet. Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse tragen hier nicht zur Lösung der philosophischen Implikationen bei. Wir wissen damit also nicht, ob es ein „Problem des tierischen Schmerzes“ gibt.
Dieser Behauptung wird freilich heftig widersprochen. Ich glaube aber, die meisten Naturwissenschaftler, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, verfügen nicht über die ganze Palette an Unterscheidungen, deren sich die Philosophie des Geistes bei den Überlegungen zu diesem Gegenstand bedient. Ich glaube also, dass der Naturwissenschaftler, der hier widerspricht, die relevanten Feinheiten der Philosophie nicht würdigt. (Die interdisziplinäre Forschung der Neurowissenschaft und Philosophie widmet sich allerdings genau derlei Fragen. Man hat behauptet, der präfrontale Kortex spiele exakt jene Rolle, die ich der Sache im Hinblick auf das phänomenale Bewusstsein zugeschrieben habe – sei es beim Schmerz oder bei anderen Sinneszuständen [3]).
Was aber zum Trubel im Netz geführt hat, war folgendes. Als ich mich Antwort 2 widmete, fiel mir auf: Wenn der präfrontale Kortex (PFC) gestört ist, so sind es auch die negativen Empfindungen, die mit dem Schmerz einhergehen. Da sich dieser Teil des Gehirns beim Säugetier als letztes herausgebildet hat, könnte es sein, dass die meisten Tiere keine negativen Empfindungen beim Schmerz haben, weil ihnen der PFC fehlt.
Dies wurde zum strittigen Punkt im Netz. Der YouTuber „skydivephil“ bemühte sich, einen Naturwissenschaftler nach dem anderen zu befragen, ob Tiere ein Schmerzempfinden haben oder nicht (eine Frage, die die philosophischen Feinheiten meines Arguments völlig außer Acht lässt) und ob sie über einen präfrontalen Kortex verfügen. Die Interviewpartner gaben durchweg an, dass Tiere freilich über einen PFC verfügten und mein Argument daher unsinnig sei. Dazu gibt es dreierlei zu sagen:
1. Selbst wenn das stimmte, wäre mein Argument nicht unsinnig. Ich habe ja nur behauptet, dass sich tierischer Schmerz – nach bisherigem Erkenntnisstand – ohne „negatives Empfinden“ ereignet. Selbst wenn die Abwesenheit eines PFC beim Menschen oft mit dem Phänomen des Schmerzes ohne negatives Empfinden korreliert ist, dann heißt das noch nicht, dass Organismen, die über einen PFC verfügen, bei auftretendem Schmerz automatisch auch die entsprechende negative Empfindung verspüren. Warum nicht? Weil wir nicht wissen, ob der Wahrnehmung des Tieres dieselben Strukturen zugrunde liegen wie der des Menschen. Auch wenn dem so ist und sie über einen PFC verfügen, heißt das noch nicht, dass sie während eines Schmerzes auch entsprechend leiden.
2. Die Richtigkeit dessen, dass Tiere (von Menschen und höheren Primaten abgesehen) über einen präfrontalen Kortex verfügen, ist nicht offensichtlich. Wie selbst die Naturwissenschaftler, die „skydivephil“ befragt hat, angeben, hat man die Trennungslinie des präfrontalen Kortex beim Tier immer wieder anders gezogen. Wer mit Neuroanatomie nicht vertraut ist, sollte bedenken, dass die Identifikation verschiedener Gehirnregionen nicht mit dem Öffnen eines Unterleibs verglichen werden kann, bei dem Magen, Nieren und Leber genau zu erkennen sind. Gehirnareale hängen eng zusammen; es gibt verschiedene Kriterien, anhand derer die einzelnen Bereiche unterschieden werden können. Anfang des 20. Jahrhunderts grenzte man den präfrontalen Kortex lokal und anhand des Zelltypus ein. Den Menschen und den höheren Primaten eignet ein bestimmter Zelltypus (auch als „Körnerzellen“ oder „Granularzellen“ bekannt), der eine bestimmte Schicht der Großhirnrinde ausmacht und der mit dem präfrontalen Kortex identifiziert wurde. Einige spätere Anatomen haben dieses Unterscheidungskriterium zur Abgrenzung des PFC verworfen, zum Teil deshalb, weil das Auffinden des PFC in niedrigeren Tierarten so fast unmöglich wurde. Spätere Gehirnforscher haben den PFC funktional als Projektionszonen eines anderen Gehirnareals definiert, der des Thalamus. Einige Nichtprimaten verfügen über solche Projektionszonen.
Ist sich die naturwissenschaftliche Meinung im Hinblick auf den PFC einig? Nein. Vor nicht allzu langer Zeit haben Kritiker genau gegen das funktionale Kriterium argumentiert und bestritten, dass Nichtprimaten über einen PFC verfügen. [4] Von einer einhelligen Meinung zu dieser Frage unter den Naturwissenschaftlern kann man also nicht sprechen.
Wie dem auch sei, wir können uns folgende Frage stellen: Welche Gehirnstruktur ist für das negative Schmerzempfinden verantwortlich? Ist es die Granularzellschicht IV? Ist es eine Projektionszone des Thalamus? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber: Wenn dieser Bereich beim Menschen gestört ist, kommt es mitunter dazu, dass die Qual beim Schmerzerlebnis verschwindet. Sollte Tieren also fehlen, was wir an dieser Stelle im Gehirn besitzen, dann könnte es durchaus sein, dass ihnen auch diese Art der Schmerzempfindung fremd ist. Die Schlussfolgerung bleibt also bestehen.
3. Selbst wenn Nichtprimaten über einen PFC verfügen, unterscheidet sich der menschliche PFC völlig von dem aller anderen Tierarten. Ein erst kürzlich erschienenes Gutachten zur Neuroanatomie der Primaten bezeichnet den menschlichen PFC als „absolut, offensichtlich und immens“ andersartig (Rilling, Trends in Cognitive Science, Vol. 18/1, Jan. 2014). Wenn es diese Unterschiede sind (die bei einer Lobotomie zerstört werden), welche ein negatives Schmerzempfinden ermöglichen, dann leiden Tiere möglicherweise nicht unter dieser Art von Schmerz.
Ich möchte noch einmal daran erinnern: Die Kontroverse betrifft nur eine einzige kleine Behauptung, die wiederum nur ein einziges Argument dieses Kapitels betrifft. Auch wenn wir Antwort 2 in Gänze verwerfen, gibt es immer noch Argumente, die man gegen die Qual tierischen Schmerzes ins Feld führen kann, indem man zeigt, dass Tiere kein Erlebnis phänomenalen Bewusstseins haben und dass man daher das Schmerzempfinden des Tieres nicht den Kategorien „Gut“ und „Böse“ zuzählen wird dürfen. Angesichts der zitierten Kritiken jedoch haben wir keinen Grund, Antwort 2 zu verwerfen.
Michael Murray
(Übers.: I. Carobbio; L: LT)
Link to the original article in English: http://www.reasonablefaith.org/animal-pain-re-visited
[1]
Vgl. http://www.educ.ethz.ch/mint/pp/ralphs/Gehirn_Schumacher_farbig.pdf
[2]
„Geistige Zustände werden als „zugriffsbewusst“ bezeichnet, wenn ihr Inhalt für Überlegungen und Handlungen verfügbar ist. Der Begriff des „Zugriffsbewusstseins“ wurde von Ned Block (1995) im Zusammenhang mit der Untersuchung des Phänomens der „Blindsicht“ eingeführt, bei dem visuelle Wahrnehmungen zwar nicht bewusst erlebt werden, aber deren Inhalte trotzdem für Überlegungen und Handlungen zur Verfügung stehen“ (Ralph Schumacher, Gehirn und Bewusstsein aus philosophischer Sicht, S. 316). [AdÜ]
[3]
Lau u. Rosenthal, “Empirical Support for higher-order theories of conscious awareness,” Trends in Cognitive Science, August 2011, vol. 15, no 8.
[4]
H. J. Markowitsch u. M. Pritzel, The prefrontal cortex: Projection area of the thalamic mediodorsal nucleus?, Physiological Psychology 7 (1) (1979), S. 1–6; T. M. Preuss, Do rats have prefrontal cortex? The Rose-Woolsey-Akert program reconsidered, in: Journal of Cognitive Neuroscience 7 (1) (1995): S. 1–24
– William Lane Craig